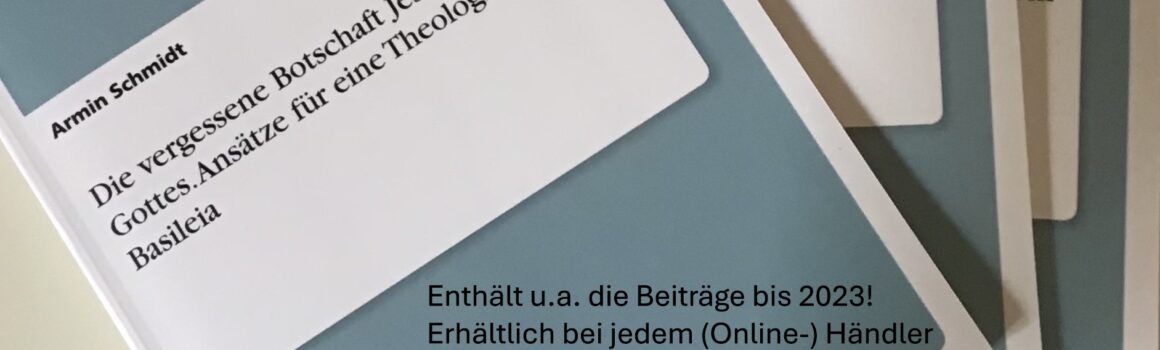[Platzhalter-Text]
-
„Jesus verkündete das Reich Gottes – gekommen ist die Kirche“
Auf den ersten Blick erscheint das Zitat von Alfred Loisy (1857-1940) beinahe zynisch. Seine Absicht war aber eine ganz andere. Er wollte der kirchlichen Hierarchie seiner Zeit, die von den Ergebnissen der historisch-kritischen Exegese aufgeschreckt war, signalisieren: Es gibt einen Weg, der vom „historischen Jesus“ zum „Christus des Glaubens“ und damit auch zu kirchlichen Strukturen…
-
Die Verkündigung Jesu und der „Gott der Apokalypse“
Im Frühjudentum spielen apokalyptische Vorstellungen eine große Rolle. Allgemein herrscht die Überzeugung, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht. Geheime Offenbarungen kündigen die Gräuel, Schrecken und Katastrophen an, die über die Menschheit hereinbrechen werden; furchterregende Zeichen am Himmel und unerklärliche Vorkommnisse erzeugen immer größere Angst und Panik. Und hinter all diesen Drohungen steht ein Gott,…
-
Totes Gestein? – Die Botschaft des historischen Jesus
Die Betrachtung der Evangelien als geschichtliche Dokumente hat es möglich gemacht, die Grundlinien der Verkündigung des historischen Jesus zu erkennen. Der ursprüngliche „jesuanische Impuls“ muss dabei aus unterschiedlichen Überlieferungsstufen und redaktionellen Bearbeitungen allerdings erst aufgewiesen werden. – Die katholische Kirche hat die Ergebnisse der neutestamentlichen Exegese seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bekämpft. Das II. Vatikanum hat…
-
Der Himmelsturz des Satans Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes
Jesus hat wahrscheinlich nicht länger als eineinhalb Jahre in Galiläa gewirkt. Diese kurze Zeit hat genügt, um zahlreiche Menschen für sich zu gewinnen – und viele, die über politischen Einfluss und religiöse Autorität verfügten, zu erbitterten Feinden zu machen. Die römische Besatzungsmacht hat dann sehr schnell die Unruhe eingedämmt und den Ruhestörer hingerichtet. Sicher hat…